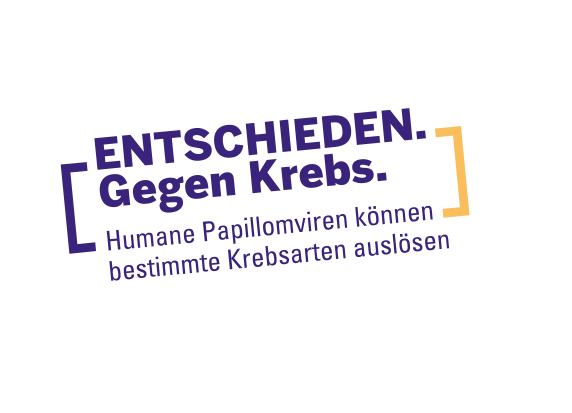MSD Gesundheit
Unser Patientenportal mit umfangreichen Informationen für Ihre Gesundheit.
Unser Fokus liegt beim Thema Impfen und der Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Krebs. Neben Fachwissen zu Ursachen, Beschwerden und möglichen Folgeschäden bieten wir Ihnen hier eine Übersicht zu Vorbeugung, Behandlungsmöglichkeiten und weiterführende Informationen zu verschiedenen Erkrankungen.
Unsere Fokusthemen
Impfungen
Informationen rund um das Thema Impfen. Erfahren Sie, warum Impfungen nicht nur bei Kindern, sondern auch im Jugend- und Erwachsenenalter so wichtig sind und wie Sie sich selbst und die Allgemeinheit durch Impfungen schützen können.
Krebserkrankungen
Die Begegnung mit der Diagnose Krebs ist immer ein massiver Einschnitt in das Leben und stellt Betroffene vor scheinbar unlösbare Aufgaben. Dabei ist es unerheblich, ob Sie selbst erkrankt sind oder Angehörige in die Situation involviert sind.
Chronischer Husten
Husten ist ein häufiges Symptom in Zusammenhang mit einer akuten Erkältungskrankheit. Diese kann spontan abklingen und der Husten sich legen. Das ist aber nicht immer so.
HIV
HIV ist gut behandelbar. Dank HIV-Medikamenten können Menschen mit HIV heute gut und lange mit dem Virus leben. Wissenswertes zum Thema HIV, zum Verlauf der Erkrankung und der Therapie finden Sie hier auf einen Blick.

Über MSD
MSD ist einer der weltweit größten und bedeutendsten Arzneimittelhersteller. Seit mehr als 130 Jahren erforschen und entwickeln wir Medikamente, Impfstoffe und Biologika. Als forschendes Pharmaunternehmen treiben wir den medizinischen Fortschritt voran.
Weitere interessante Themen
Das Immunsystem
Das Immunsystem ist ein ausgeklügeltes Abwehrsystem, das dafür zuständig ist, den Körper vor Schäden und Eindringlingen zu schützen. Wie es funktioniert, lesen Sie hier.
Informationen zur Impfung gegen HPV
Für Informationen zur Impfung gegen HPV besuchen Sie bitte auch entschiedengegenkrebs.de.
Leben nach der Krebstherapie: Mein Zweites Erstes Mal
Wie kann der Weg zurück ins Leben nach Abschluss einer Krebstherapie gelingen und was ist zu beachten?
DE-NON-04204